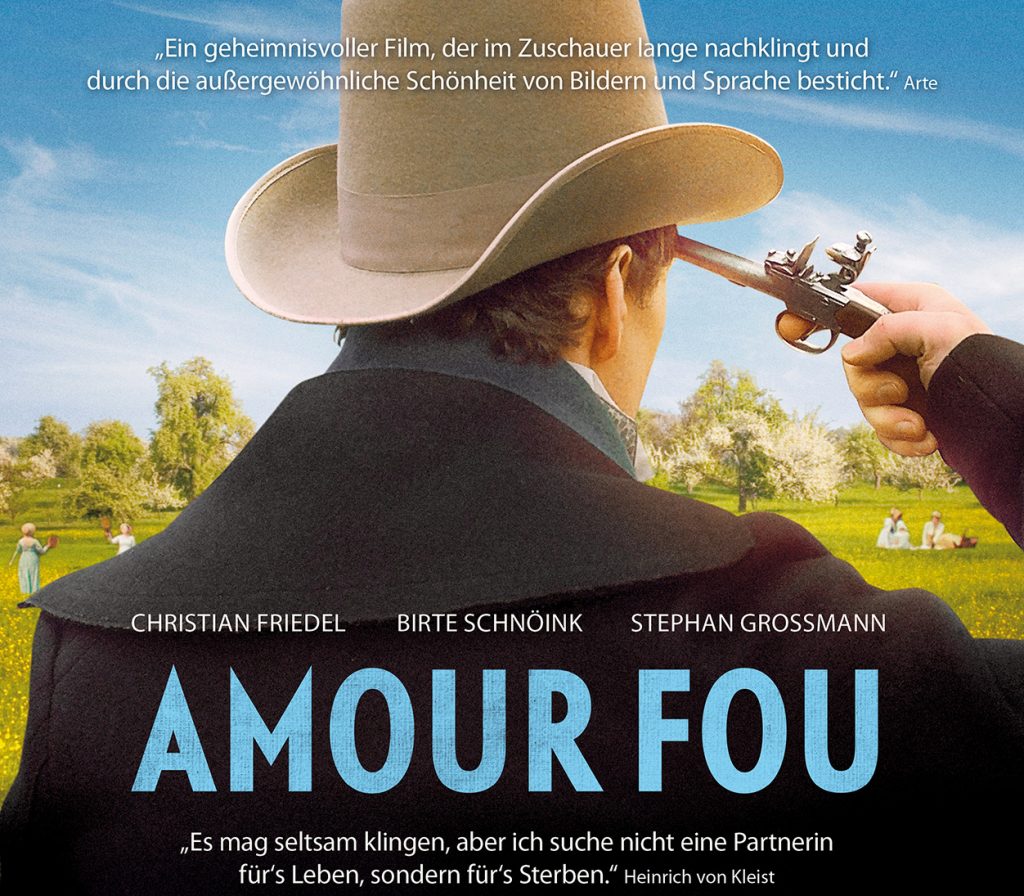Zu Gast in Leipzig bei der Filmkunstmesse
„Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, daß was geschieht!“ Weiter im Text des uralten Gassenhauers heißt es dann unter anderem: „Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück“ oder „Rebellion, Rebellion in den Katakomben“ Als Erster sang der Schauspieler Gustaf Gründgens diese Zeilen in dem Film „Tanz auf dem Vulkan“. Der Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels war über die Handlung und die Filmmusik nicht unbedingt erfreut. Trotzdem lief dieser Film im Jahr 1938 erstaunlicherweise unzensiert in den Kinos des Deutschen Reichs. Ich habe nicht auf dem Vulkan getanzt, rebelliert oder mich über die Maßen alkoholisch berauscht. Aber zum Schlafen bin ich nicht nach Leipzig gekommen. Und so waren meine Leipziger Nächte sehr lang, spannend, lustig und hochinteressant. Ich bereue keine schlaflose Minute. Zum 16. Mal veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V. in Leipzig die Filmkunstmesse. Leipzig kann nämlich nicht nur Bücher, sondern auch Filme! Vom 19. Bis 23. September fanden sich dieses Jahr über tausend Kinobetreiber, Verleiher und Fachleute der Arthouse-Branche in der Messestadt ein. An zwei Tagen mischte sich auch die Blindgängerin als Vertreterin der Ki-noblindgänger gemeinnützige GmbH gemeinsam mit Lena unters Kinovolk. Nur wer ein Badge um seinen Hals trug wie früher die Schlüsselkinder den Hausschlüssel, hatte freien Zutritt zu allen Kinovorstellungen, Veranstaltungen und natürlich zu den abendlichen Partys und Preisverleihungen. Lena und ich gehörten dazu und das war ein tolles Gefühl! Ermöglicht hat das die AG Kino – Gilde, die uns freundlicherweise unkompliziert und kostenlos auf die Teilnehmerliste setzte. Dafür bedanken wir uns noch einmal herzlichst! Wir hatten also die wunderbare Qual der Wahl: Bei insgesamt 74 Filmen konnten wir uns aus Zeitgründen leider nur einige aussuchen. Konzentriert haben wir uns dabei auf ausländische Filmproduktionen, die möglichst erst im nächsten Jahr offiziell in den Kinos starten. Die Messe war die ideale Gelegenheit, sich schon einmal nach einem neuen Projekt für die Kinoblindgänger gGmbH umzuschauen. Unter den acht Filmen, die wir geschafft haben, wurden wir auch fündig! Die meisten liefen als Original mit Untertitel. Die französischsprachigen Filme verstand ich ganz gut, den auf Englisch, na ja, und beim Spanischen mußte ich dann doch weitgehend passen. Bei zwei Vorstellungen gab es die Möglichkeit, die App CinemaConnect von der Firma Sennheiser einmal auszuprobieren. Diese Gelegenheit haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Sennheiser ist Partner und Sponsor der Filmkunstmesse und stattete extra für diese beiden Vorstellungen zwei Kinosäle mit seiner Technik aus, einem WLAN. Zuerst loggten wir uns mit unseren Smartphones im Kinosaal in dieses Netz ein. Damit hatten wir über die App Zugriff auf die französische Originalfassung des Films „Einfach das Ende der Welt“, die wir über unsere Kopfhörer hören konnten. Auf der Leinwand wurde währenddessen die deutsche Sprachversion abgespielt. Im Prinzip hat das zwar funktioniert, allerdings benötigt man dazu Kopfhörer, die einen zu 100 Prozent von den Außengeräuschen abkapseln. Die Meinigen, übrigens von Sennheiser, sind für solche Zwecke nicht gedacht. Ich hatte mit einem leichten Knistern die französische Fassung über Kopfhörer, und viel lauter die deutsche gleichzeitig in meinen Ohren. Das war eindeutig zu viel und so habe ich nach einigen Minuten das Experiment abgebrochen. Was die App CinemaConnect noch so alles kann und wie sie sich dabei von der App Greta und Starks unterscheidet, kann man sich in dem Hörspiel unter folgendem Link einmal anhören: Ein Hörspiel Der nächste Film lud nach Norwegen ein, natürlich auch als Originalfassung, und endlich war es soweit! Torsten Frehse von Neue Visionen Filmverleih (oben rechts im Bild) begrüßte das Fachpublikum zu „Welcome to Norway“, der am 13. Oktober startet. Dann war ich an der Reihe, die Kinoblindgänger gGmbH kurz vorzustellen, und konnte mit der ersten barrierefreien Fassung für diesen Film auch schon ein Ergebnis vorweisen. Die von Neue Visionen und Kinoblindgänger gemeinsam finanzierte Audiodeskription und Untertitel waren auch schon über die App Greta und Starks verfügbar. Lena und ich konnten uns also gleich einmal die Audiodeskription von der Greta ins Ohr flüstern lassen. Der Letzte soll der Nächste werden! „Mein Leben als Zucchini“ stand als letzter Film auf unserem Programm. Das gesamte Publikum schmolz bei dem Animationsfilm dahin und ließ sich von der Musik von Sophie Hunger verzaubern. Dieser Familienfilm aus der Schweiz wird Projekt Nummer drei der Kino-blindgänger und bekommt zum Kinostart am 16. Februar 2017 eine barrierefreie Fassung. Vorher wird aber noch Weihnachten mit „A Holy Mess“ am 22.12.2016 gefeiert. Für Lena und mich hieß es nach der zweiten noch längeren Nacht, leider Abschied von der Filmkunstmesse zu nehmen. Aber nächstes Jahr hängen wir mindestens eine dritte Nacht dran!
Zu Gast in Leipzig bei der Filmkunstmesse Weiterlesen »